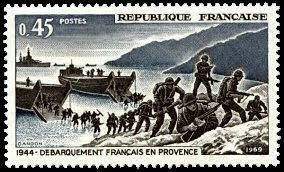|
| Der Mistral schafft einen wolkenlosen Himmel Bild Steffen Lipp |
„Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdient Ventosus, den Windigen nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen".Und weiter seine Eindrücke vom Gipfel:
"Zuerst stand ich, durch einen ungewohnten Hauch der Luft und durch die ganz freie Rundsicht bewegt, einem Betäubten gleich da.“
 |
| Steffen Lipps Blick vom Mont Ventoux in Richtung Alpen |
Sein Blick, der Mistral hatte die Sicht klar gewischt, ging vom Rhonetal zu den Alpen, dann zum Mittelmeer und bis hin zu den Pyrenäen.
Die gesamte Beschreibung seines Aufstiegs finden Sie in deutscher Übersetzung HIER .
Die beiden Fragen indes bleiben: War er wirklich oben? Und hat er wirklich diesen Brief geschrieben? "Beides nein", sagt Rainer Schmitz in seinem Buch "Was geschah mit Schillers Schädel". Der Brief sei erst siebzehn Jahre nach dem vorgegebenen Datum verfaßt worden. Und da war der Empfänger schon zehn Jahre tot. Den Brief hält Schmitz für eine Fälschung. Er imitiere
"eigentlich nur einen Bericht des Livius über die Besteigung des Berges Hämus durch König Philipp von Macedonien."Auf diese Quelle verweist auch der Brief selbst.
Bereits in der Antike war der Mistral den Menschen ein furchterregendes Naturschauspiel. Der griechische Geograph Strabon nennt ihn „Melanboreas“, schwarzer Nordwind, ein Begriff, der in der Dauphiné noch im 19. Jahrhundert gebräuchlich war, als er überall sonst schon Mistral hieß. Der Name leitet sich her vom lateinischen magistralis, ein Meisterwind also. Wer einen mehrere Tagen andauernden Mistral nicht erlebt hat, darf nicht für sich in Anspruch nehmen den Midi zu kennen.
Nach Norden haben die alten Häuser dickere Mauern und allenfalls eine kleine Fensteröffnung zeigt sich an der ganzen Hauswand. Wolf von Niebelschütz ist in seiner Beschreibung der Provence aufgefallen, daß dies auch für Kirchen galt.
„Die Kirchen haben nach Norden auch kein Fenster, nach Westen kein Portal, stämmig und klein sind die Türme, und auf den Feldern zieht man zehn Meter hohe Palisaden aus Zypressen, die eng beieinanderstehen, und ihre Lücken bindet man mit Bambusgeflechten aus, und doch kommt es vor, daß der Mistral sie aushebt mit all ihren Wurzeln."Für die außerordentliche Gewalt dieses „Chefs unter den Winden“ sammelte der englische Reiseautor Archibald Lyall drastische Beispiele.
„Der Mistral hat schon Eisenbahnzüge zum Stehen gebracht und sogar einmal einen Zug ohne Lokomotive das Gleis entlang von Arles nach Port Saint Louis geschoben. 1875 kam er mit solcher Gewalt herab, daß er die Brücke zwischen Beaucaire und Tarascon hinwegriß.“