Ausführliche und einfühlsame Biographien schreibt er und ist den Objekten seiner Begierde so lange so nah wie selten ein Biograph. Stundenlang liegt er mit seinem Markenzeichen, der Lupe, auf dem Bauch, beobachtet und spricht auch mit seinen Insekten. Seine Beschreibungen sind so verständnisvoll, daß er manchmal sicher nur aufschreibt, was seine Tiere ihm erzählen.
 |
| Fabre: Immer mit seiner Lupe unterwegs und hier mit Blick auf das Café de Commerce, die inzwischen geschlossene Stammbar des deutschen Malers Werner Lichtner-Aix |
„Ich glaube nicht an Gott, ich sehe ihn“,war Fabres feste Überzeugung.
Zeitlos, besser gesagt mit unendlich viel Zeit, hat Fabre geforscht und experimentiert. Der erste, der das Experiment in der Biologie systematisch anwandte. Über vierzehn Jahre hinweg hat Fabre immer wieder den Mistkäfer beobachtet, mit dem er seine Veröffentlichung auch beginnt. Um die Intelligenz des Skarabäus, des heiligen Pillendrehers aus Ägypten, ranken sich viele Mythen. Insbesondere der schon von den griechischen Geschichtsschreibern überlieferte Mythos, daß der Skarabäus sich Hilfe holt, wenn das Gelände so schwierig wird, daß er eine von ihm gefundene Mistkugel nicht mehr allein fortbewegen kann. Bis ins 19. Jahrhundert hatten selbst ernsthafte Wissenschaftler diese Theorie ungeprüft übernommen.
Und auch Fabres Ansatz war es zunächst, eine Bestätigung für diese These zu erlangen. Er umgrenzte die Kugel mit unüberwindlichen Steinwällen, hob Gräben aus, fixierte sie mit Nadeln und ließ sich eine Reihe weiterer Erschwernisse einfallen, aber nie, nie holte der Mistkäfer Hilfe. Im Gegenteil. Wenn die Artgenossen feststellten, daß jemand „Hilfe“ brauchte, hielten sie dies für Schwäche und die Aufforderung zu Kampf und Raub. Das war es also, wenn mehrere Käfer sich um eine Kugel versammelten.
Alle Vorgänger Fabres hatten aus einer Ansammlung der Tiere ihre im wahrsten Sinne des Wortes voreiligen Schlüsse gezogen. Der Berliner Matthes&Seitz Verlag hat die „Erinnerungen eines Insektenforschers“ in einer mehrbändigen Reihe und mit den Zeichnungen von Christian Thanhäuser schön ausgestatteten Ausgabe verlegt. HIER können Sie sich das im VIDEO ansehen.
 |
| Zeichnung von Christian Thanhäuser aus dem angesprochenen Buch |
Nach der Besichtigung des Hauses - HIER alle Informationen und Öffnungszeiten; Mittagspause im Juli und August übrigens von 12.30 bis 15.30! - schlage ich noch einen Spaziergang durch den botanischen Garten am Fabre-Haus und dann hinaus zum Friedhof vor, wo er im Familiengrab beerdigt ist.
„Diejenigen, die wir verloren glauben, sind uns nur vorausgeschickt.“Diesen Ausspruch Senecas hat sich Fabre für seinen Grabstein ausgesucht.
Hier auf dem Friedhof finden Sie auch das Grab des deutschen Maler Werner Lichtner-Aix, der seit dem Ende der sechziger Jahre in Sérignan wohnte und dessen Atelier auch heute noch zu besichtigen ist.
Bei der Gelegenheit möchte ich Sie auf die Website der französischen Friedhöfe von PHILIPPE LANDRU hinweisen, eine wahre Fundgrube. Auch ein Bild des Fabres-Grab finden Sie da.
>>>> Viel mehr zu Sérignan, Fabre, Ventoux und dem Midi in meinem Buch "Durch den Süden Frankreichs" (700 Seiten, über 1.000 Bilder), das ich gerne signiert und portofrei zusende.
So bewertet die FAZ: Eine „profunde Kulturgeschichte, glänzend formuliert, prachtvoll bebildert und vom Verlag wunderschön ausgestattet…die vielleicht fundierteste Darstellung zu diesem Thema, ganz gewiss ist es die am besten geschriebene“.
Professor Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, lobt im MDR die „hochinteressante Mischung aus Literatur, Kunst und Kulinarik“, und Martin-Maria Schwarz im HR „eine akribische Neuerkundung“. Zusammenfassend die Badische Zeitung: „Ein reiseliterarisches Meisterwerk“ und der NDR: „Ein ganz außergewöhnliches Buch!“











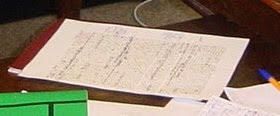





















.JPG)
.JPG)